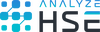
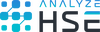


Am 13.04.2024 hatten wir von der ANALYZE HSE GmbH die großartige Möglichkeit, am Lacrima Beneflitz 2024 teilzunehmen, einem Spendenlauf, der nicht nur sportliche Herausforderungen bot, sondern auch eine Gelegenheit war, gemeinsam Gutes zu tun. Mit großer Motivation und Teamgeist machten wir uns auf den Weg, um 20 Kilometer für den guten Zweck zu absolvieren. Neben Kollegen der ANALYZE HSE GmbH konnten wir auch weitere kleine und große Mitstreiter aus unserem familiären Umfeld gewinnen, mitzumachen.
Der Lacrima Beneflitz fand im idyllischen Ostra Gelände in Dresden statt, einem Ort, der eine perfekte Kulisse für sportliche Aktivitäten bietet. Im Zentrum aller Bemühungen stand LACRIMA, ein Angebot der Johanniter in Dresden, welches Begleitung bei der Trauerbewältigung für Kinder und Jugendliche anbietet (Lacrima - Kindertrauerzentrum Dresden der Johanniter | Johanniter).
Ein schöner Aspekt des Lacrima Beneflitz war die tolle Stimmung. Bei jeder Runde, die wir absolvierten, wurden wir von den anderen Teilnehmern und Zuschauern angefeuert. Vielen Dank an die Organisatoren vor Ort und an alle Läufer unseres Teams!
Autorin: Anne Michel
Lagereinrichtungen und Ladungsträger spielen eine entscheidende Rolle in vielen Arbeitsumgebungen, sei es in Lagerhallen, Produktionsstätten oder Logistikzentren. Damit der Betrieb dieser Einrichtungen sicher und effizient erfolgen kann, ist es wichtig, sich an bestimmte Vorgaben zu halten. Eine wichtige Informationsquelle kann in diesem Zusammenhang die im November 2023 erschienene DGUV Information 208-061 „Lagereinrichtungen und Ladungsträger“ sein, die auf der DGUV Regel 108-007 „Lagereinrichtungen und -geräte“ basiert.
Sie betrachtet folgende Aspekte:

Die DGUV Information gilt im Allgemeinen für Lagereinrichtungen und Ladungsträger. Lagereinrichtungen umfassen dabei ortsfeste und verfahrbare Regale und Schränke, während Ladungsträger wiederverwendbare Paletten mit oder ohne Stapelhilfsmittel sowie Stapelbehälter sind.
Die rechtlichen Grundlagen sind dabei von entscheidender Bedeutung, doch ist es oftmals schwer herauszufiltern welche im Konkreten relevant sind. Die DGUV-Information hilft dabei und stellt die Einhaltung europäischer Binnenmarktrichtlinien wie dem ProdSG und nationaler Anforderungen wie der Arbeitsstättenverordnung und der Betriebssicherheitsverordnung in den Vordergrund.
Unterschiede zwischen nicht kraftbetriebenen und kraftbetriebenen Lagereinrichtungen werden ebenfalls berücksichtigt.
Neben der Einhaltung rechtlicher Grundlagen spielt auch der korrekte Betrieb eine große Rolle und ist vor allem für den Arbeitsschutz von Bedeutung. Ein sicherer Betrieb erfordert eine Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisungen und regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter. Zudem müssen Belastungsgrenzen eingehalten und Maßnahmen zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände ergriffen werden.
Auch regelmäßige Prüfungen von Lagereinrichtungen gemäß Betriebssicherheitsverordnung sowie Kontrollen von Ladungsträgern und Stapelhilfsmitteln sind unerlässlich, da sie Störungen frühzeitig erkennen und Unfälle vermeiden können. Dabei ist zu beachten, dass Prüfpersonen bestimmte Qualifikationen erfüllen müssen.
Neben der korrekten Bedienung und der Prüfung sind vorbeugende Instandhaltung und Wartung gemäß Herstellervorgaben sowie eine systematische Störungsbeseitigung Teil eines effektiven Arbeitsschutz- und Sicherheitskonzepts.
Diese Schritte benötigen eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Lagereinrichtungen und Ladungsträgern im Betrieb sowie eine präventive Erarbeitung entsprechender Maßnahmen vor, während und nach einer Störung bzw. eines Unfalls.
Für genau diese Themen bietet die DGUV Information "Lagereinrichtungen und Ladungsträger" einen umfassenden Leitfaden um den sicheren Betrieb, die Prüfung und die Instandhaltung dieser wichtigen Arbeitsmittel zu gewährleisten. Durch die Beachtung können Betriebsunfälle vermieden und die Effizienz im Arbeitsalltag gesteigert werden.
Autorin: Julia Weigelt
Die Verwendung fluorierter Treibhausgase ist seit 2006 in der Verordnung (EG) Nr.842/2006 und der Richtlinie 2006/ 40/ EG geregelt. Seit dem 1. Januar 2015 gilt die Verordnung (EU) Nr.517/2014 über fluorierte Treibhausgase (F-Gase-VO). Diese Regelung soll einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der Emissionen des Industriesektors in der EU um 70 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990 leisten. Im Fokus stehen Kältemittel, welche z. B. in Kälteanlagen als Kreislaufmedium eingesetzt werden; tritt im Kreislauf eine Undichtigkeit auf, entweicht das Kältemittel und wirkt fördernd auf den Treibhauseffekt ein. Das soll durch das sukzessive Verbot dieser sog. F-Gase unterbunden werden.
Am 5. Oktober 2023 konnte ein Kompromissvorschlag zur Novellierung der F-Gase-VO erzielen. Nun muss dieser Vorschlag noch formell von Rat und Parlament angenommen werden.

Betreiber bestimmter Anlagen wurden bereits durch die Verordnung aus 2006 mit einer Vielzahl von Verpflichtungen betraut. Mit der Einführung der neuen F-Gase-Verordnung bleiben diese im Wesentlichen bestehen. Zusätzliche Pflichten treten hinzu, während andere in der neuen Verordnung modifiziert sind. Die Betreiberpflichten gelten für folgende Anwendungen:
Folgend wird ein Ausschnitt der Betreiberpflichten präsentiert, wobei nicht alle Verpflichtungen für jede genannte Anwendung gleichermaßen gelten:
Autorin: Anne Michel
Auf Grundlage des am 17.11.2023 veröffentlichten Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) sind alle Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch von mehr als 2,5 GWh pro Jahr verpflichtet auf der Plattform für Abwärme bis zum 31.03. eines jeden Jahres bestimmte Angaben zu übermitteln und Änderungen unverzüglich zu aktualisieren (§17 Absatz 2).
Das Ziel der Plattform für Abwärme ist es eine Übersicht über die gewerblichen Abwärmepotentiale in Deutschland zu schaffen, damit diese Abwärmepotentiale im zweiten Schritt für mögliche Interessenten nutzbar gemacht werden können und die Energieeffizienz in Deutschland gesteigert werden kann.

Die verpflichtenden Angaben umfassen dabei folgende Informationen (§17 Absatz 1):
Wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in einer Informationsveranstaltung mitteilte und auch bereits in §17 Absatz 3 erwähnte, wird die Plattform für Abwärme in einen öffentlichen und einen nicht-öffentlichen Teil untergliedert werden, um sensible und betriebsinterne Daten besser zu schützen.
Ursprünglich war anhand der Übergangsvorschrift nach §20 Absatz 4 die Frist zur ersten Übermittlung der Daten der 01.01.2024. Da jedoch bis zum jetzigen Stand weiterhin die Plattform für Abwärme noch nicht veröffentlich ist und die Herausforderung der Bereitstellung all dieser Daten für die Unternehmen immens ist, wurde die Frist der Erstübermittlung auf den 01.07.2024 verlängert.
Als Hilfestellung hat die Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) als Teilbereich des BAFA ein Merkblatt für die Plattform für Abwärme veröffentlicht. Dieses soll regelmäßig aktualisiert werden, so dass stets darauf geachtet werden sollte mit der aktuellsten Version zu arbeiten.
In dem Merkblatt wird als Abwärmequelle jede geführte oder diffuse Abwärmequelle einer Anlage definiert (siehe auch EnEfG §3 Nr. 2). Bisher gibt es seitens des Gesetzgebers noch keine Ausnahme- oder Vereinfachungsregeln, so dass bisher jede Abwärmequelle (jedes festes, flüssiges oder gasförmiges Medium sowie Strahlungswärme von Oberflächen) zu betrachten wäre. Generell gibt hier das BAFA die Empfehlung sich von den signifikantesten Abwärmequellen zu den weniger signifikanten Abwärmequellen vorzuarbeiten.
Da oftmals mehrere Abwärmequellen zu einer großen Abwärmequelle zusammengefasst werden (beispielsweise in Kühltürmen) sollte die abschließende größte Abwärmequelle bevorzugt betrachtet werden.
Jede bereits genutzte Abwärmequelle muss nicht gemeldet werden. Eine sich anbahnende Nutzung einer Abwärmequelle wiederum müsste trotzdem kommuniziert werden.
Jede Abwärmequelle ergibt über den zeitlichen Verlauf und der Vergleichstemperatur (z.B. des Nah- oder Fernwärmenetzes oder der Eingangstemperatur des Mediums) ein Abwärmepotential bzw. die jährliche Wärmemenge. Welche Vergleichstemperatur dabei für die unterschiedlichen Anwendungsfälle genutzt werden soll, soll in einer aktualisierten Version des Merkblattes noch veröffentlicht werden.
Falls keine Messungen oder genauen Berechnungen vorliegen, kann auch mit plausiblen Schätzungen gearbeitet werden. Dies müsste aber entsprechend in der Meldung transparent angegeben werden. Als Hilfestellung wird auch auf den Abwärmerechner vom Bayrischen Landesamt für Umwelt verwiesen.
Bei der Erstellung der Leistungsprofile sollen vor allem die saisonalen Unterschiede aber auch die tageszeitlichen Unterschiede herausgearbeitet werden. Ruhezeiten aufgrund von Wochenendstille, Wartungen, Revisionen oder auch außerplanmäßige Ausfallzeiten sind bei der Erstellung der Leistungsprofile der Abwärmequellen entsprechend zu berücksichtigen.
Eine Meldung, dass an keinem Standort des Unternehmens Abwärmepotentiale vorliegen, muss nicht erfolgen.
Unternehmen, die nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig die Daten fristgerecht übermitteln, können mit einer Ordnungswidrigkeit in Höhe von bis zu 50.000 € belangt werden.
Bei spezifischen Einzelfällen kann das BAFA diesbezüglich kontaktiert werden und steht als beratende Instanz zur Seite.
Autor: Felix Berlin