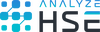
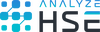

Seit dem 4. August 2024 gilt die novellierte EU-Richtlinie über Industrieemissionen (IED). Ziel ist es, Menschen und Umwelt besser vor Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung durch Industrieanlagen und Tierhaltung zu schützen – und dabei Klima- und Ressourcenschutz stärker zu verankern.
Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Zusätzliche wichtige Aspekte im Überblick
Deutschland übernimmt die EU-Vorgaben 1:1 in ein Mantelgesetz, mehrere Verordnungen und ein Verwaltungsvorschriftenpaket. Ziel: Rechtssicherheit für Unternehmen.
Was ändert sich konkret?
Die novellierte IED bringt mehr Pflichten, aber auch mehr Chancen – besonders für Unternehmen, die frühzeitig in nachhaltige Technologien und Umweltmanagement investieren.
Jetzt prüfen:
Autorin: Anne Michel
In Zeiten steigender Umweltprobleme und einem wachsenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit werden Unternehmen zunehmend dazu aufgefordert, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren und transparenter über ihre Aktivitäten zu berichten. In diesem Kontext sind Umweltmanagementsysteme ein wertvolles Werkzeug, das Unternehmen dabei unterstützen kann, ihre Berichtspflichten nach der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zu erfüllen. In diesem Blog werden wir die Vorteile eines Umweltmanagementsystems (UMS) nach EMAS III in Bezug auf die Erfüllung der Berichtspflichten nach CSRD genauer betrachten.
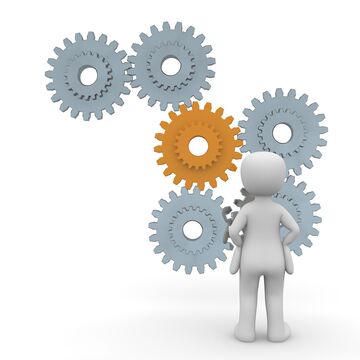
Fazit:
In einer Zeit, in der Umweltprobleme und Nachhaltigkeit immer größere Bedeutung erlangen, ist die Umsetzung eines Umweltmanagementsystems nach EMAS III und die Erfüllung der Berichtspflichten gemäß CSRD eine strategische Entscheidung für Unternehmen. Es ermöglicht ihnen, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren, ihre nachhaltige Entwicklung voranzutreiben und gleichzeitig die Anforderungen der CSRD zu erfüllen. Durch diese Synergie können Unternehmen ihr Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit unter Beweis stellen und zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen. Gerne beraten wir ihr Unternehmen zur EMAS III.
Autorin: Anne Michel
Im Zuge der Gasmangellage wurde am 26.10.2022 die BG-V (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen anlässlich eines Brennstoffwechsels wegen einer ernsten oder erheblichen Gasmangellage) verabschiedet.
Diese Verordnung beinhaltete Erleichterungen für die Errichtung, den Betrieb, die Änderung und Wiederinbetriebnahme von Anlagen u.a. in Genehmigungs- und Prüfverfahren. Typischerweise waren davon vor allem diesel- oder ölbasierte Aggregate betroffen, die während der Gasmangellage entweder als Notstromaggregat oder zur Wärmebereitstellung genutzt und in dieser Zeit zusätzlich errichtet wurden.
Die BG-V war für zwei Jahre und damit bis zum 26.10.2024 befristet und hat somit größtenteils Ihre Gültigkeit verloren.
Relevanz von § 9 Abs. 3 BG-V:
Für viele Unternehmen bleibt insbesondere § 9 Abs. 3 der Verordnung von Bedeutung. Dieser sieht vor, dass Anlagen, die während der Geltungsdauer der BG-V in Betrieb genommen oder wesentlich geändert wurden und weiterhin betrieben werden sollen, den Anforderungen der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ (AwSV) entsprechen müssen. D.h. Unternehmen sind verpflichtet, sämtliche notwendigen Anpassungsmaßnahmen bis spätestens sechs Wochen nach dem 26.10.2024, also bis zum 07.12.2024, umzusetzen und die entsprechenden Nachweise der zuständigen Behörde vorzulegen.
Alternativ ist der Nachweis über die Stilllegung der betroffenen Anlage zu erbringen.
Fazit:
Sollte diese Frist – beispielsweise aufgrund von Herausforderungen im Weihnachtsgeschäft oder dem Jahresabschluss – unbeachtet geblieben sein, wird dringend empfohlen, die erforderlichen Maßnahmen schnellstmöglich nachzuholen, um regulatorische und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Autor: Felix Berlin
Die Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichte steigen rasant, und Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, die komplexen Standards der EU-Regulierungen – insbesondere die neuen Europäischen Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – zuverlässig umzusetzen. Hier setzt die neue Kooperation zwischen plant values und saxess an: Gemeinsam entwickeln sie ein ESG-Reporting-Tool, das speziell darauf ausgelegt ist, Unternehmen bei der Erfüllung der neuen Berichterstattungspflichten praxisnah zu unterstützen.
Um dieses Tool optimal an die Bedürfnisse der Anwender anzupassen, suchen plant values und saxess derzeit Pilotkunden, die an der Entwicklung teilhaben und diese durch praxisnahe Einblicke bereichern möchten. Dies ist eine einmalige Gelegenheit für Unternehmen, frühzeitig Zugang zu einer maßgeschneiderten Lösung zu erhalten und die eigene Berichterstattung nachhaltig und wiederholbar zu gestalten.

Werden Sie Teil dieses Innovationsprojekts!
Für die Entwicklung dieses Tools setzen plant values und saxess auf enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, um eine möglichst praxisnahe Lösung zu schaffen. Besonders Unternehmen aus der Sozialwirtschaft und der Dienstleistungsbranche sind herzlich eingeladen, Pilotkunde zu werden – aber auch jede andere Branche ist willkommen.
Interessiert? Dann freuen sich plant values und saxess auf Ihre Kontaktaufnahme! Schicken Sie Ihnen eine kurze Nachricht über deren Kontaktformular oder rufen Sie direkt an.
Autorin: Anne Michel