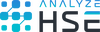
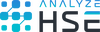


Am 20. September 2024 veranstaltete die ANALYZE HSE GmbH einen inspirierenden Workshop mit Ramon Thielecke, der den Fokus auf die individuelle Rolle jedes Teammitglieds und dessen Identifikation mit dem Unternehmen legte. Während des Workshops reflektierten wir unsere persönlichen Antriebe und wie sie zu den gemeinsamen Zielen von ANALYZE HSE beitragen. Jeder von uns bringt eine einzigartige Perspektive ein – sei es im Bereich Qualitätsmanagement, Arbeitsschutz oder Umweltschutz, dabei verbindet uns der Wert und Grundgedanke durch individuelles Handeln Nachhaltigkeit zu fördern. Durch den Austausch wurden individuelle Stärken sichtbar, die uns helfen, diesen Wert in allen Aspekten unserer Arbeit zu verankern.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Workshops war, dass unsere Kultur der Bodenständigkeit und Kundenorientierung durch unseren gemeinsamen persönlichen Antrieb für nachhaltige Lösungen gestärkt wird. Wir setzen auf langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften mit unseren Kunden, um Lösungen zu schaffen, die nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll sind. Unsere kontinuierliche Weiterentwicklung und Weiterbildung ist dabei ein entscheidender Faktor. Unsere Kundenbeziehungen sind geprägt von Vertrauen und Zuverlässigkeit, wir möchten nicht nur Lösungen anbieten, sondern auch als verlässlicher Partner fundiertes Wissen weitergeben. Diesen Ansatz haben wir im Workshop gemeinsam reflektiert und weiter gestärkt, um auch in Zukunft nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und voranzubringen.
Autorin: Julia Weigelt
Im Sommer 2024 hat die Europäische Union eine weitreichende "Lieferkettenrichtlinie" beschlossen, die auf die Schaffung nachhaltigerer Lieferketten in Europa abzielt. Diese Richtlinie, bekannt als Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), verpflichtet große europäische und internationale Unternehmen dazu, bestimmte Umwelt- und Menschenrechtsstandards in ihren Liefer- und Wertschöpfungsketten innerhalb der EU einzuhalten.
Sie gilt für europäische Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten und einem jährlichen Nettoumsatz von über 450 Millionen Euro. Für ausländische Unternehmen gilt sie, wenn sie in der Union mehr als 450 Millionen Euro Nettoumsatz erzielen. Die Richtlinie tritt in drei Phasen in Kraft. Drei Jahre nach Inkrafttreten gilt sie für EU-Unternehmen mit über 5.000 Beschäftigten und einem jährlichen Nettoumsatz von über 1.500 Millionen Euro sowie für entsprechende ausländische Unternehmen. Vier Jahre nach Inkrafttreten gilt sie für EU-Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten und einem jährlichen Nettoumsatz von über 900 Millionen Euro oder entsprechende ausländische Unternehmen. Nach fünf Jahren gilt sie für alle betroffenen Unternehmen mit den eingangs genannten Schwellenwerten.

Die Richtlinie bringt vor allem Änderungen in Bezug auf die Reichweite der Pflichten innerhalb der Liefer- oder Aktivitätenkette, die detaillierte Ausgestaltung der Sorgfaltspflichten und die explizite Einführung einer zivilrechtlichen Haftung mit sich. Unternehmen, die der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) unterliegen, sind jedoch von der Pflicht zur jährlichen Berichterstattung über die Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten befreit, da sie diese mit dem CSRD- Bericht bereits erfüllen.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt der CSDDD ist die Erweiterung der umweltbezogenen Sorgfaltspflichten. Aufbauend auf dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) führt die CSDDD neue Verpflichtungen ein, die über die bisherigen Regelungen hinausgehen. Die Richtlinie berücksichtigt internationale Umweltabkommen, darunter:
Hinzu kommt ist die Verpflichtung der Unternehmen, einen Plan zur Minderung ihrer Auswirkungen auf den Klimawandel zu erstellen und umzusetzen. Dieser Plan soll sicherstellen, dass ihre Geschäftsmodelle und Strategien mit dem Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft und der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius gemäß dem Pariser Abkommen und den europäischen Klimaneutralitätszielen vereinbar sind. Die Vorgaben für die Gestaltung dieses Plans orientieren sich am delegierten Rechtsakt ESRS E1, der die klimabezogenen Anforderungen aus der CSRD konkretisiert. Es reicht aus, wenn ein Unternehmen einen Klimaplan im Sinne der CSRD vorlegt; ein separater Plan gemäß der CSDDD ist dann nicht mehr erforderlich.
Zu diesen bestehenden Pflichten wurden neue Anforderungen eingeführt, die den Schutz der biologischen Vielfalt, gefährdeter Arten, geschützter Gebiete und Meere betreffen. Dies schließt Verweise auf internationale Abkommen ein wie:
Innerhalb der Bundesregierung übernimmt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die federführende Verantwortung für die Umsetzung der Richtlinie. Die CSDDD muss innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten in nationales Recht umgesetzt werden.
Autorin: Anne Michel
Die Verordnung (EU) 2024/1781 dient der Schaffung eines neuen Rahmens für die Festlegung von „Ökodesign-Anforderungen“ an Produkte. Hersteller von Produkten, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, müssen die darin enthaltenen Anforderungen einhalten. Andernfalls darf das jeweilige Produkt innerhalb der EU nicht angeboten oder verkauft werden.

Hintergrund:
Der Regelungsinhalt der neuen Ökodesign-Verordnung ist nicht gänzlich neu. Bereits die Vorgängerrichtline 2009/125/EG hat den Rahmen für Mindestanforderungen an Effizienz und umweltgerechte Gestaltung von energieverbrauchsintensiven Produkten definiert. Die konkreten Anforderungen wurden für die einzelnen Produktkategorien (z.B. Leuchtmittel, Kühlschränke, Elektromotoren) in separaten EU-Durchführungsverordnungen geregelt, die anschließend in das nationale Recht der EU-Mitgliedsstaaten überführt werden mussten.
In Deutschland erfolgte die Umsetzung durch das Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz (EVPG) und die EVPG-Verordnung (EVPGV).
Unternehmen, die bereits von der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG betroffen sind, sollten sich frühzeitig mit den neuen Anforderungen auseinandersetzen. Hierzu zählt insbesondere auch die CO2- bzw. Treibhausgasbilanzierung respektive die Schaffung der hierfür notwendigen Managementstrukturen im Unternehmen.
Autor: Johann Breiter
Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) hat auf die derzeitigen Schwierigkeiten bei der Beantragung von Beihilfen nach der BEHG-Carbon-Leakage-Verordnung (BECV) und der Strompreiskompensation (SPK) reagiert.
Hintergrund ist, dass Unternehmen, die einen entsprechenden Antrag stellen möchten, Gegenleistungen nachweisen müssen. Der Nachweis der Gegenleistung bedarf der Bestätigung einer „prüfungsbefugten Stelle“, z. B. einer Zertifizierungsstelle. Viele Unternehmen befürchten, dass sie aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit von prüfungsbefugten Stellen bis zum 01.07.2024 (Ausschlussfrist in 2024) keinen Nachweis vorlegen können und somit keinen Antrag auf Beihilfe einreichen können.
Die DEHSt hat am 14.06.2024 in Reaktion auf die aktuellen Probleme darüber informiert, dass im Einzelfall vom „Rechtsgedanken der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“ Gebrauch gemacht werden soll. Die Frist wird dabei nicht verlängert, jedoch wird das antragstellende Unternehmen so gestellt, als hätte es die Frist nicht versäumt. Bei den Folgen der Wiedereinsetzung handelt es sich also um eine Fiktion, die dazu führt, dass trotz fehlender Antragsvoraussetzungen eine Beihilfe gewährt werden kann. Dies wiederum setzt voraus, dass die Antragsfrist unverschuldet oder nur mit geringem Verschulden versäumt wurde.
Hinweise
Autor: Johann Breiter